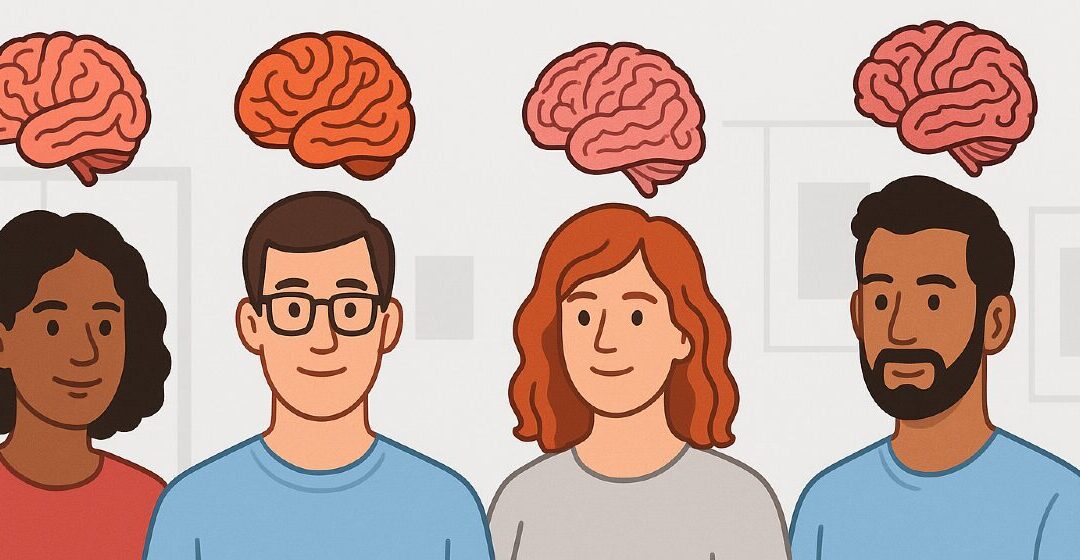Neuroleadership – Führen mit und fürs Gehirn
Ich bin neugierig und lerne gerne dazu. Das Gehirn und seine Funktionen haben mich schon lange fasziniert und ich habe immer wieder darüber gelesen und gelernt. Vor einigen Wochen saß ich in einem Seminarraum und freute mich auf das Thema Neuroleadership. Die Referentinnen sprachen mit Begeisterung über Gehirnareale, Serotonin, Dopamin, Oxytocin und die erstaunliche Plastizität unseres Denkorgans. Nach einiger Zeit fiel mir auf: Vieles, was hier präsentiert wurde, hatte ich in anderer Form schon gehört. Und zwar unter den Schlagworten empathische Führung, resiliente Führung oder authentische Führung. Nur diesmal eben mit der Brille der Neurowissenschaften: Neuroleadership als neuer Blickwinkel.
Inhaltsverzeichnis
Neues Leadership-Label: Was steckt hinter Neuroleadership?
In der Führungswelt gibt es mittlerweile eine ganze „Vokabelsammlung“: transformational, situativ, agil, servant, mundfaul – und nun eben Neuroleadership. Der Reiz liegt auf der Hand: Neurowissenschaft klingt modern, messbar, fundiert. Doch die Gefahr besteht, dass man Bekanntes nur neu verpackt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Neuroleadership Definition: Wissenschaftliche Grundlagen für Führungskräfte
Neuroleadership ist der Versuch, Erkenntnisse der Hirnforschung gezielt auf Führungssituationen anzuwenden. Ein Versuch, der sich aus meiner Sicht lohnt, denn das Verständnis für menschliche Reaktionen erhöht sich deutlich, wenn Sie verstehen, was sich im Gehirn abspielt.
Das „Hausorchester“ des Gehirns – Neurotransmitter und ihre Wirkung
Werfen wir einen Blick auf das „Hausorchester“ unseres Gehirns – die Neurotransmitter. Diese winzigen Botenstoffe spielen zusammen wie ein gut eingespieltes Ensemble: Dopamin gibt den Takt der Motivation vor und lässt uns Ziele mit Vorfreude ansteuern. Serotonin sorgt für Grundstimmung und innere Balance, während Oxytocin wie ein harmonischer Akkord Vertrauen und Verbundenheit stärkt. Die Endorphine wiederum sorgen für Energie und Hochleistung. Und dann gibt es Cortisol – den lauten Perkussionisten, der bei Stress den Puls hochtreibt. Wer dieses Zusammenspiel kennt, versteht besser, warum manche Führungsimpulse beflügeln und andere blockieren.
Vier neurobiologische Hebel für wirksame Führung
Das Wissen über diese Neurotransmitter und ihr Zusammenspiel hilft in folgenden Situationen:
- Belohnungssysteme verstehen: Wie Motivation im Gehirn entsteht – und wie sie durch Anerkennung, Zielklarheit und Autonomie aktiviert werden kann.
Ein Beispiel:
Ein Scrum Master stellt fest, dass das Entwicklerteam beim Umbau eines alten, fehleranfälligen Moduls wenig Begeisterung zeigt – der Nutzen ist für Außenstehende kaum sichtbar. Er integriert deshalb in jedes Daily-Stand-up eine kurze „Bug Count“-Visualisierung, die zeigt, wie viele Fehlermeldungen im Modul seit Beginn der Arbeit verschwunden sind. Nach jedem Sprint wird das Team für den Fortschritt gelobt, und einzelne clevere Code-Lösungen werden im Review hervorgehoben.
Warum hilft das?
Das regelmäßige Sichtbarmachen kleiner Verbesserungen setzt Dopamin frei, weil Erfolge unmittelbar erkennbar werden. Die persönliche Anerkennung im Teammeeting erhöht zudem Oxytocin, was den sozialen Zusammenhalt und die Bereitschaft steigert, auch „unsichtbare“ Aufgaben motiviert anzugehen. - Stressreaktionen regulieren: Was im limbischen System passiert, wenn Druck steigt – und wie Führungskräfte deeskalierend wirken können.
Ein Beispiel:
In einer Krisensitzung bricht ein Lieferant weg, und die Stimmung im Team kippt in Panik. Die Führungskraft senkt bewusst die Stimme, formuliert einen klaren Fahrplan in drei Schritten und betont, dass es Lösungsoptionen gibt. Er oder sie bittet die Beteiligten, kurz tief durchzuatmen, bevor sie Aufgaben verteilen.
Warum hilft das?
Das limbische System produziert in Stressmomenten vermehrt Cortisol, das Kampf- oder Fluchtreaktionen auslöst. Durch ruhige Kommunikation und klare Struktur hilft der Abteilungsleiter, den Cortisolspiegel zu senken und den präfrontalen Kortex (hier wird „nachgedacht“) wieder „online“ zu bringen – was rationale Entscheidungen begünstigt. - Lernprozesse fördern: Warum Wiederholung, emotionale Relevanz und Feedback nachhaltiger wirken als reine Wissensvermittlung.
Ein Beispiel:
Nach einem Fehlstart bei einer neuen Software-Einführung veranstaltet die Führungskraft wöchentliche, 30-minütige Mini-Workshops, in denen nicht nur Funktionen erklärt, sondern auch kleine Erfolgsgeschichten aus dem Team geteilt werden. Jede Session endet mit einem kurzen, positiv formulierten Feedback an die Teilnehmenden.
Warum hilft das?
Wiederholung festigt neuronale Verbindungen. Die emotionale Relevanz der geteilten Erfolgserlebnisse steigert Dopamin und Oxytocin (soziale Bindung), während konstruktives Feedback ebenfalls dopaminfördernd wirkt – das macht die Lernerfahrung nachhaltiger. - Entscheidungen zu unterstützen: Wie entstehen kognitive Verzerrungen und wie erkenne ich sie.
Ein Team muss zwischen zwei Marketingstrategien wählen. Statt direkt abstimmen zu lassen, bittet die Führungskraft jeden, zuerst mögliche Risiken und Vorteile schriftlich festzuhalten, ohne Gruppendiskussion. Erst danach werden die Punkte verglichen.
Warum hilft das?
Diese Vorgehensweise minimiert den Einfluss von dopaminbedingter Euphorie für die vermeintlich spannendere Option und reduziert Cortisol-bedingte Stressentscheidungen. Gleichzeitig unterstützt sie die Aktivität im präfrontalen Kortex, der für logisches Abwägen zuständig ist.
Diese Mechanismen sind wissenschaftlich gut untersucht und geben Führungskräften hilfreiche Anknüpfungspunkte, um Entscheidungen, Kommunikation und Teamkultur bewusst zu gestalten.
Eine kurze und prägnante Zusammenfassung finden Sie bei Loretta Graziano Breuning, emeritierte Professorin an der California State University.
Leider ist das Thema doch ein bisschen komplexer als nur 4 Neurotransmitter, es spielen noch einige andere Neurotransmitter und sonstige chemische und physikalische Vorgänge eine Rolle. Aber die Kenntnis über diese 4 Neurotransmitter helfen schon einmal enorm.
Neuroleadership im Alltag: Beispiele aus der Führungspraxis
In meiner Arbeit als Coach erlebe ich, dass ein neuro-informierter Blick in folgenden Alltagssituationen besonders wertvoll ist:
- Feedbackgespräche: Die Reihenfolge der Botschaften und der Tonfall beeinflussen, ob das Gegenüber in den Verteidigungsmodus geht oder offen bleibt. Ein wertschätzender Einstieg aktiviert das Belohnungssystem und erhöht die Aufnahmebereitschaft.
- Change-Phasen: Wer versteht, wie sehr unser Gehirn auf Sicherheit programmiert ist, kann Veränderung mit mehr psychologischer Stabilität begleiten. Gezieltes Schaffen von Orientierung senkt Cortisol und hält den präfrontalen Kortex handlungsfähig.
- Fokus & Produktivität: Kurze, klare Arbeitsphasen mit Pausen entsprechen der natürlichen Aufmerksamkeitsspanne besser als endlose Meetings. Das hält die Dopamin-Level stabil und verhindert mentale Erschöpfung.
Brauchen Führungskräfte Neuroleadership wirklich?
Die Grundprinzipien guter Führung – Vertrauen, Klarheit, Empathie, Orientierung – haben sich nicht geändert. Neuroleadership liefert jedoch eine präzisere Landkarte: Es erklärt, warum bestimmte Führungsverhaltensweisen wirken und bietet wissenschaftliche Argumente, die manchmal mehr überzeugen als reine Erfahrungswerte.
Für mich persönlich war die Weiterbildung ein wertvoller Perspektivwechsel. Ich habe nicht völlig neue Führungsinstrumente mitgenommen – aber ich habe verstanden, warum die bewährten Werkzeuge funktionieren. Das gibt mir zusätzliche Sicherheit, sie bewusst einzusetzen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Marga Jäger und Lisa Steininger von der GenHuman GmbH.
Fazit: Neuroleadership als Werkzeug für wirksame Führung
Wenn Sie als Führungskraft in einer komplexen Welt wirksam sein wollen, ist Neuroleadership kein Zaubertrick. Es ist eher wie eine gute Lesebrille: Es schärft den Blick für Zusammenhänge, die Sie vielleicht schon immer geahnt haben – und übersetzt sie in eine Sprache, die auch Ihr Team versteht.
Neugierig geworden?
Möchten Sie Ihren Führungsstil mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen schärfen?
In meinen Coachings verbinden wir aktuelle Hirnforschung mit praxiserprobten Führungswerkzeugen – individuell, wirksam, umsetzbar. Schreiben Sie mir, und wir finden gemeinsam heraus, wie Neuroleadership Sie und Ihr Team voranbringen kann.